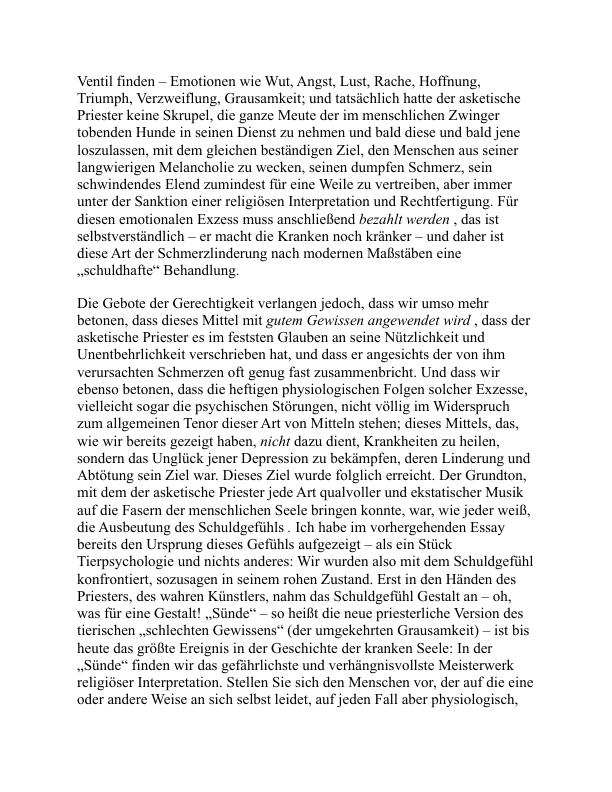Your cart is currently empty!
Die Genealogie der Moral – Friedrich Nietzsche (The Genealogy of Morals – Deutsch)
Die Genealogie der Moral wurde erstmals 1887 auf Deutsch veröffentlicht und war als Erläuterung und Ergänzung zu Nietzsches Abhandlung Jenseits von Gut und Böse aus dem Jahr 1882 gedacht. In seinem letzten veröffentlichten Werk, Ecce Homo, beschrieb Nietzsche die Essays, aus denen die Genealogie der Moral besteht, als „drei entscheidende Annäherungen eines Psychologen an eine Neubewertung aller Werte“ und behauptete, sie seien „was Ausdruck, Streben und die Kunst des Unerwarteten betrifft, vielleicht das Merkwürdigste, was je geschrieben wurde“. Obwohl diese Selbsteinschätzung vermutlich übertrieben ist, gilt Die Genealogie der Moral allgemein als inhaltlich und stilistisch einzigartiger Beitrag zur Philosophie. Der Stil…
Description
Die Genealogie der Moral – Friedrich Nietzsche (The Genealogy of Morals – Deutsch)
Deutsch version
Die Genealogie der Moral wurde erstmals 1887 auf Deutsch veröffentlicht und war als Erläuterung und Ergänzung zu Nietzsches Abhandlung Jenseits von Gut und Böse aus dem Jahr 1882 gedacht. In seinem letzten veröffentlichten Werk, Ecce Homo, beschrieb Nietzsche die Essays, aus denen die Genealogie der Moral besteht, als „drei entscheidende Annäherungen eines Psychologen an eine Neubewertung aller Werte“ und behauptete, sie seien „was Ausdruck, Streben und die Kunst des Unerwarteten betrifft, vielleicht das Merkwürdigste, was je geschrieben wurde“. Obwohl diese Selbsteinschätzung vermutlich übertrieben ist, gilt Die Genealogie der Moral allgemein als inhaltlich und stilistisch einzigartiger Beitrag zur Philosophie.
Der Stil ist absichtlich schwierig und soll abwechselnd ermutigen, abstoßen und irreführen. „In jedem Fall“, schrieb er, „ist der Anfang darauf angelegt, zu mystifizieren; er ist kühl, wissenschaftlich, sogar ironisch, absichtlich in den Vordergrund gedrängt, absichtlich zurückhaltend. … Am Ende, in jedem Fall, leuchtet unter furchtbaren Donnerschlägen eine neue Wahrheit zwischen dichten Wolken hervor.“ Im ersten Essay führt Nietzsche die Idee des Ressentiments ein, der Quelle und Grundlage (seiner Meinung nach) der christlichen und jüdischen Religion und des grundlegenden psychologischen Mechanismus des damit verbundenen „Sklavenaufstands“ in der Moral, einer Umkehrung der Bewertungen durch die Unterdrückten, um ihre Machtlosigkeit und die damit einhergehende Frustration zu kompensieren und sie ertragen zu können. Nietzsche stellt „edlen“ Werten, deren zentraler Gegensatz „gut“ und „böse“ in Bezug auf die Menschen selbst ist, „sklavischen“ Werten gegenüber, deren zentraler Gegensatz „gut“ und „böse“ in Bezug auf Handlungen ist.
Das Prahlen mit diesem Gegensatz im Christentum stellt laut Nietzsche „den großen Aufstand gegen die Herrschaft edler Werte“ dar, die im heidnischen Rom und im antiken Griechenland üblich waren. Der zweite Essay beginnt mit einer Erörterung von Versprechen und dem Wert des Vergessens, und verfolgt dann die Ursprünge von Schuld und schlechtem Gewissen bis hin zur selbstverschuldeten Grausamkeit, der nach innen gerichteten Anwendung eines von Natur aus brutalen animalischen Instinkts, der daran gehindert wurde, nach außen Ausdruck zu finden.
Nietzsche fährt mit einer Analyse von Ursprung und Zweck der Bestrafung in menschlichen Gesellschaften fort. „Grausamkeit“, behauptet Nietzsche kontrovers in Ecce Homo , „wird hier zum ersten Mal als eines der ältesten und unentbehrlichsten Elemente im Fundament der Kultur entlarvt.“ „Askete Ideale“, deren „drei große Prunkworte Armut, Demut und Keuschheit sind“, sind das Thema des dritten Essays, des längsten des Werks und vielleicht seines rhetorischen Höhepunkts. Nietzsche betrachtet hier das asketische Ideal, wie es von Künstlern, Gelehrten und Priestern verkörpert wird, und stellt Unterschiede zwischen den drei Gruppen in Ausdruck und Wirkung des Ideals fest. Er fragt nach der Macht asketischer Ideale, da sie seiner Meinung nach generell schädlich für Gesundheit und Wohlbefinden sind.
Er kommt zu dem Schluss, dass die Macht des asketischen Ideals aus einem historischen Mangel an konkurrierenden Idealen erwächst und dass „der Mensch eher das Nichts wünscht als gar nichts“. Im Gegensatz zur landläufigen Auffassung, eine wissenschaftliche Weltanschauung stehe prinzipiell im Widerspruch zur Religiosität, da letztere die natürliche Heimat asketischer Ideale sei, folgert Nietzsche aus seiner Analyse des „Willens zur Wahrheit“, dass das Verhältnis von Wissenschaft zu asketischen Idealen selbst keineswegs antagonistisch ist. Vielmehr „stellt die Wissenschaft die fortschreitende Kraft in der inneren Entwicklung dieses Ideals dar“; mehr noch: „Die Wertschätzung asketischer Ideale zieht unweigerlich die Wertschätzung der Wissenschaft nach sich.“ Interessanterweise verwickelt Nietzsche sich selbst und seine eigene Genealogie auch in die Bewahrung asketischer Ideale und identifiziert die Verbindung zwischen solchen Idealen und der Philosophie selbst als sehr stark.
Der dritte Essay ist bemerkenswert, da Nietzsche ihn als eine Übung in der Darlegung eines Aphorismus herausstellt. Gelehrte, insbesondere Christopher Janaway, sind sich uneinig, ob der Aphorismus, zu dem der Essay angeblich einen Kommentar abgibt, das Motto seines früheren Werks Also sprach Zarathustra ist oder vielmehr der erste der nummerierten Absätze des Essays. Nietzsches turbulenter, planlos gelehrter Stil hat zu seiner gemischten Rezeption in der Philosophie und der breiteren Kultur beigetragen und zu der Auffassung, dass ihm literarische Virtuosität ebenso wichtig war wie philosophische Klarheit. Trotz der literarischen Komplexität seines Werks kann man sich – wie Bertrand Russell es in seiner Geschichte der westlichen Philosophie tat – inhaltlich fragen: „Was sollen wir von Nietzsches Lehren halten?
Inwieweit sind sie wahr? Sind sie überhaupt nützlich? Enthalten sie irgendeine Objektivität oder sind sie bloße Machtfantasien eines Invaliden?“ „An Nietzsche kommt man nicht vorbei“, schrieb HL Mencken 1908.
„Man kann ihn für ein Zischen und Spotten halten und im Vorbeigehen die Tugendröcke heben, doch sein Gebrüll klingt in Ihren Ohren, und seine Gotteslästerungen dringen in Ihr Gedächtnis ein.“ Ob uns ihre blasphemischen Sympathien nun anziehend oder abstoßend finden, und ob ihre Analyse unsere anfänglichen ethischen Vorannahmen letztlich verunsichert oder nur bestärkt, die Genealogie der Moral bleibt ein grundlegendes Werk der Ideengeschichte, dessen moralische und politische Relevanz kaum Anzeichen eines Nachlassens zeigt.
Info
The Genealogy of Morals – Friedrich Nietzsche, Deutsch (Die Genealogie der Moral – German) can be downloaded up to 5 times within 14 days of purchase. Your purchase includes access to multiple downloadable eBook formats:
- AZW3: Used only on Kindle devices and apps
- EPUB: Widely supported on most e-readers except Kindle
- HTML: Can be opened in any web browser — ideal for online reading.
- MOBI: For older Kindle devices.
- PDF: Printable and viewable on nearly all devices — ideal for fixed-layout content.
- RTF: Rich Text Format — works with most word processors and supports basic formatting.
- TXT: Plain text format — universally compatible, but no formatting.
Have questions?
Check out our FAQs page for quick answers. If you need further assistance with your purchase, feel free to contact us — we’re here to help!
Additional information
| Original Title | The Genealogy of Morals |
|---|---|
| Author | Friedrich Nietzsche |
| Translated Title | Die Genealogie der Moral |
| Translation Language | Deutsch, German |
| Reading Ease | 36.4 |
| Reading Time | 3 hours 12 minutes |
Related products
Discover all our classics!
Questions? View our FAQs.